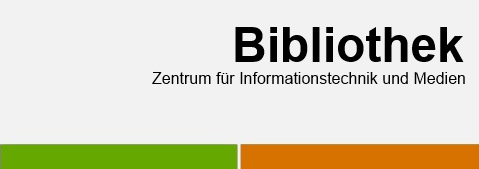Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Bericht (74) (entfernen)
Schlagworte
- Berufsorientierung (2)
- Bildungsübergang (2)
- NRW-Zentrum für Talentförderung (2)
- Talentförderung (2)
- Talentscouting (2)
- Westfälische Hochschule (2)
- Controlling (1)
- Digitale Revolution (1)
- Digitalisierung (1)
- Energiepolitik (1)
Institut
- Wirtschaftsrecht (41)
- Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt (9)
- Strategische Projekte (6)
- Institut für Innovationsforschung und -management (4)
- Institut für Internetsicherheit (4)
- Wirtschaft Gelsenkirchen (3)
- Informatik und Kommunikation (2)
- Westfälisches Institut für Gesundheit (2)
- Westfälisches Energieinstitut (1)
Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt die Ziele, über die Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens zu berichten, diese bewertbar zu machen und im Sinne eines Regelkreisgedankens des Controllings zu steuern. Im Zuge dieser Studie wurden vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen aus dem westlichen Münsterland zum aktuellen Stand ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung befragt. Dabei wurden sowohl die auf die Unternehmen eingehenden ESG-Anforderungen, etwaig genutzte Rahmenwerke der Berichterstattung, die innerbetriebliche Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements und die Erwartungen der Unternehmen betrachtet.
Ein Forschungsprojekt der Universität Siegen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn. Das Vorhaben "MINTdabei" — Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals (YWMP) beim Berufseinstieg und -aufstieg in berufliche Selbstständigkeit und Mittelstand" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01FP1620 gefördert.
Wir untersuchten Berufseinstieg und -aufstieg von YWMP in der beruflichen Selbstständigkeit und als Angestellte in mittelständischen Unternehmen, um durch die Identifikation spezifischer Probleme und Herausforderungen, insb. bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln. Ziel des Projektes ist es, damit einen kurz-, mittel- und langfristigen Beitrag zur Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals zu leisten.
Einige Städte im Ruhrgebiet haben die vielfältigen Herausforderungen im Umwelt-, Klima-, Mobilitäts-, Wirtschafts- und Bildungsbereich mit ganzheitlichen Strategien, die z.T. an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientiert sind angegangen. Es werden einige ausgewählte Städte in ihren Zielsetzungen, organisatorischen Strukturen und Handlungsfeldern betrachtet und erfolgreiche Faktoren herausgestellt.
"NRW-Talentscouting kurz und knapp" ist ein Handbuch für NRW-Talentscouts. Es präsentiert in aller Kürze die wichtigsten praktischen Themen und Fragestellungen des NRW-Talentscoutings. Es gibt u. a. Anregungen zur Gesprächsführung, Tipps zur Organisation und Planung der Arbeit von NRW-Talentscouts in Schulen und stellt wichtige Instrumente der Talentförderung vor.
Mehr als 70 NRW-Talentscouts von 17 Partnerhochschulen beraten und begleiten mittlerweile an über 370 Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien in ganz Nordrhein-Westfalen über 17.000 junge Talente (Stand 06/2019) bei ihrem Übergang von der Oberstufe in die Berufsausbildung oder ein (duales) Studium bis in den Beruf. Im Fokus des NRW-Talentscoutings stehen leistungsstarke Jugendliche und junge Erwachsene aus weniger privilegierten Familien mit viel Motivation und Engagement.
Das Magazin stellt u. a. alle 17 im NRW-Talentscouting kooperierenden Partnerhochschulen mit ihren Talentscouting-Teams vor. Es beleuchtet die Entstehung des NRW-Talentscoutings seit 2011 an der Westfälischen Hochschule hin zu einem landesweiten Programm und Entwicklungen in der Talentförderung. Es präsentiert die Qualifizierungsmöglichkeiten für diverse Zielgruppen im NRW-Zentrum für Talentförderung. Ein Schwerpunktthema sind zudem Stipendien als eines der wichtigsten Instrumente in der Förderung von Bildungsaufsteiger*innen. Erfahren Sie in einer Reportage mehr über die Arbeit der NRW-Talentscouts und lernen Sie einige der Talente kennen, die von Talentscouts auf ihrem Weg begleitet werden. In verschiedenen Porträts erzählen Talente ihre ganz persönliche Geschichte, von ihren Wünschen, Träumen und über ihre Erfahrungen bei der Studien- und Berufsorientierung.
Forschungsbericht 2012
(2013)